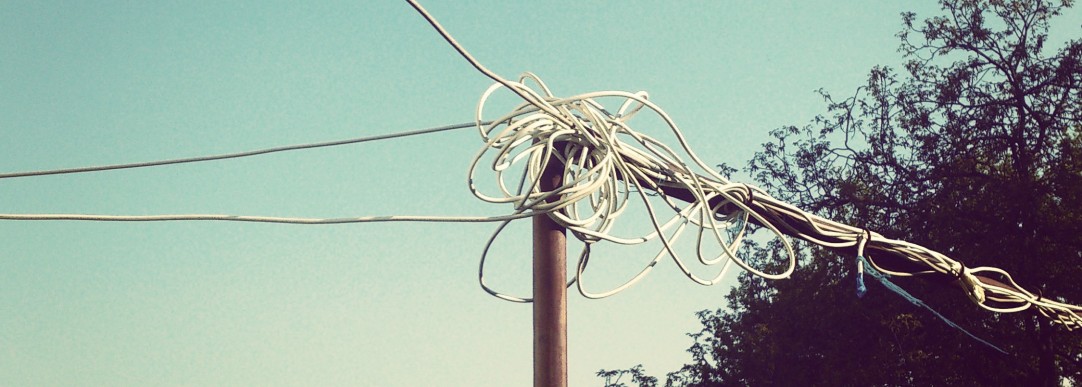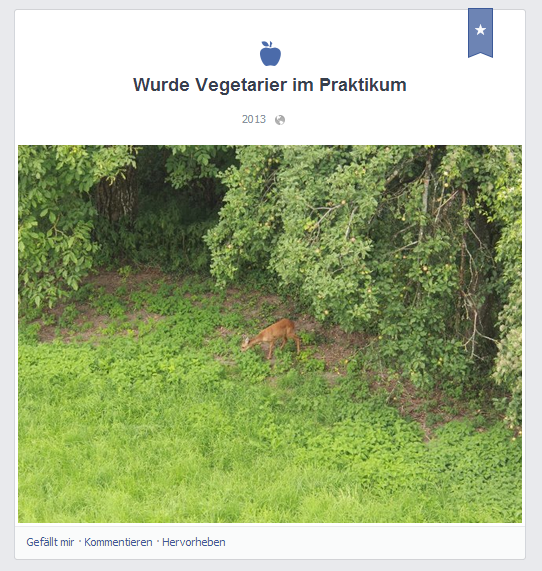Am Wochenende trendete #armeleuteessen auf Twitter. Dabei ging es aber nicht um Gerichte, die schon zu früheren Zeiten als „Arme-Leute-Essen“ bezeichnet wurden. Es geht um den Selbstversuch des Magazins Biorama, das herausfinden möchte, wie „bio“ man sich ernähren kann, wenn man vom Existenzminimum lebt.
Prinzipiell ist es keine schlechte Idee, sich Gedanken darüber zu machen, ob und wie gesunde und nachhaltige Lebensweise mit geringstem Einkommen zu vereinbaren sind, welche Möglichkeiten es gibt und wo die Grenzen sind. Geht man ein paar Schritte weiter, finden sich vielleicht auch neue Ideen Armut zu bekämpfen bzw. gesunde Ernährung auch den finanziell Schwächsten in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.
Das mit den Selbstversuchen ist aber immer so eine Sache und gerade dieser Punkt wurde auch stärksten diskutiert. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt das Leben am Existenzminimum, in Obdachlosigkeit und/oder mit einer Behinderung ist. Als Nichtbetroffener erhält man lediglich einen minimalen Einblick in die Situation der Betroffenen. Der Erfahrungswert wird allzu leicht überschätzt. Es ist einfach was anderes, ob ich mich freiwillig einen Tag mit einem Rollstuhl bewege oder ob ich unter Umständen lebenslang gezwungen bin, mich mit einem Rollstuhl zu fortzubewegen, mit allen Hürden des Alltages.
Mit Armut verhält es sich nicht anderes. Armut ist ein Komplex, dass sich nicht darauf reduzieren lässt, wenig bzw. keine finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Es ist zu kurzsichtig gedacht, den Aspekt „Essen“ unabhängig von diesem Spektrum und nur in Bezug auf „wenig Geld“ zu untersuchen. Geschweige denn anhand des feststehenden Betrages, der in der Mindestsicherung rechnerisch für Essen vorgesehen ist. Denn Menschen, die von einer Mindestsicherung leben, sind genau wie alle anderen von ungeplanten zusätzlichen Ausgaben betroffen und oft ist das Essensbudget das einzige, wo Einsparungen möglich sind.
Auch das Essen lässt ist nicht einfach nur biologisch auf „Nahrungsaufnahme“ zu reduzieren. Essen und Trinken haben viel mit Tradition, Weltanschauungen und Wohlbefinden zu tun. Essen hat eine sehr große soziale Komponente und gerade das seelische Wohlbefinden hat einen großen Einfluss auf das Ernährungsverhalten. Es ist nicht schwer die Verbindung zwischen Essen und dem Leben mit Existenzängsten und Stigmatisierung herzustellen, unabhängig davon ob vielleicht noch ein paar Euro für Bio-Lebensmittel übrig sind oder nicht.
Und ganz abgesehen davon, dass Lebenssituationen wie Armut sehr komplex und weitreichend sind: Warum ist es überhaupt notwendig, sich im Rahmen eines Selbstversuchs einen Einblick in diese Lebenssituationen zu verschaffen, wenn es doch genügend Menschen gibt, die mit diesen Lebenssituationen auch tatsächlich leben? Warum greift man nicht auf deren Erfahrungsschatz zurück, gibt ihnen den Raum darüber zu sprechen und nimmt sie dabei auch als Experten ihrer Lebenslage ernst?
Zum Abschluss habe ich für euch ein paar empfehlenswerte Links zum Thema:
Vom Luxus über #armeleuteessen zu fantasieren
Die Verachtung der Armen
Prolls, Assis, Schmarotzer – Warum unsere Gesellschaft die Armen verachtet (ein etwas längerer Podcast, aber er lohnt sich!)